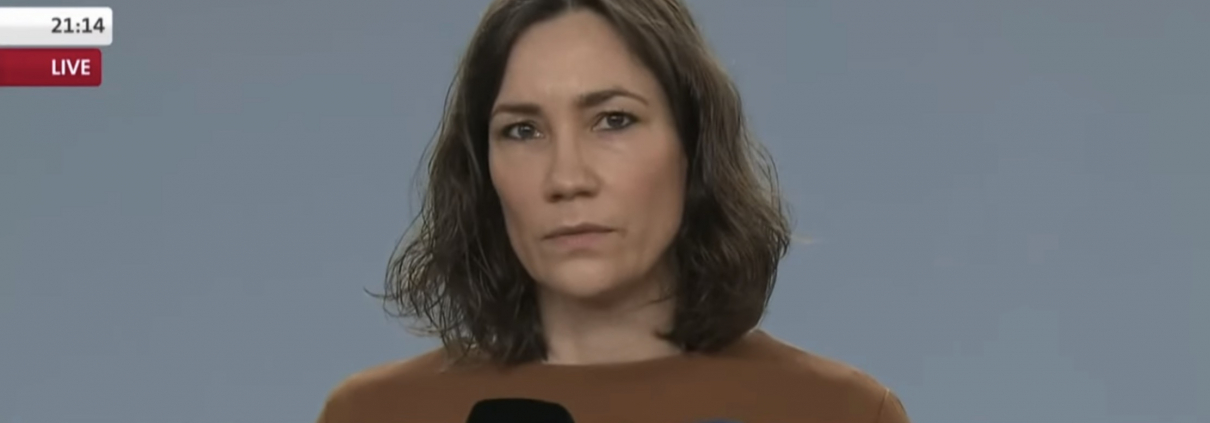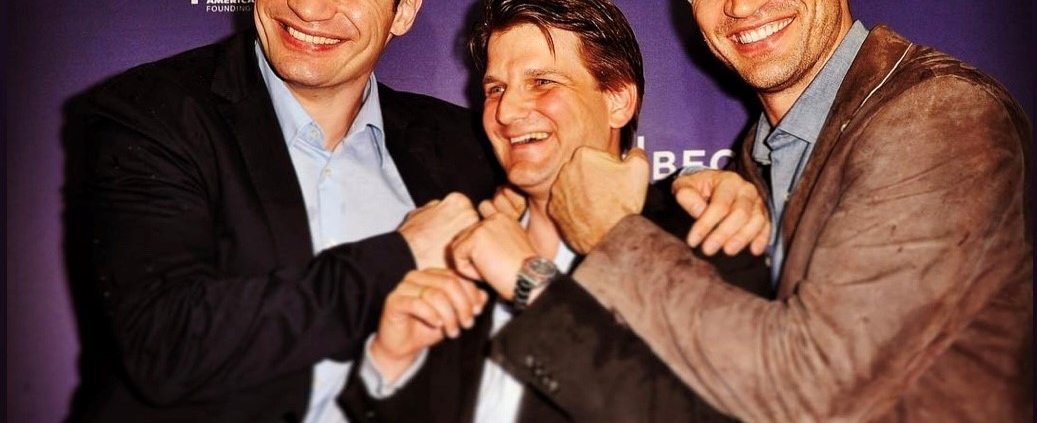Newsletter 13. Mai 2022
Newsletter vom 13.05.2022
Wo Schönheit an Verwahrlosung grenzt oder: Ist Köln hübsch hässlich? Was Pater Brown mit unserer Stadt zu tun hat
Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Kölner Presseclubs,
„Hübsch hässlich habt ihr’s hier“, sagte der Schauspieler Heinz Rühmann, als er 1960 den Pater Brown spielte. Ein klassisches Film-Zitat. Das würde auch auf Köln zutreffen, dachte ich, als ich einen der Punkte streifte, an denen Schönheit von Verwahrlosung kontrastiert wird. Die „römische Hafenstraße“ etwa. Die 33 Meter lange Strecke aus historischen Pflastersteinen liegt unweit des Kölner Doms und ist eine klassische Sehenswürdigkeit. Wer ihr nahe tritt, dem schlägt nach wenigen Metern der beißende Uringeruch entgegen, auf den man hier so häufig trifft. Was für ein harter Schnitt, um im Filmjargon zu bleiben.
Oder die Johannisstraße. Wer bis vor kurzem deren Endstück unter den Bahnhofgleisen durchquerte, wurde nur von der Nähe des Doms davon abgehalten, das eigene Schuhwerk verbrennen zu wollen – angesichts des Drecks, den Menschen, Tiere und Witterung dort hinterlassen hatten. Mittlerweile hat der Ort eine Grundreinigung erfahren. Aber als Kulisse für einen Gruselfilm taugt er noch immer. Es gibt noch mehr Gleichzeitigkeit an Hui und Pfui. Markiert wird sie von Fragen amtlicher Zuständigkeit und Lethargie. Aber ich will Ihnen nicht den Appetit verderben.
Zumal Köln sich verändert. Die Gerch-Gruppe reißt Bauten südlich des Doms ab, um Platz für das geplante „Laurenz Carré“ zu schaffen. Auch die Industriebrache, auf der Klöckner-Humboldt-Deutz bis Anfang der 90er Jahre Motoren in Mülheim baute, scheint wieder ins Bewusstsein gerückt. Mittlerweile muss die Stadt sich einem Wettlauf mit dem Verfall der historischen Bausubstanz stellen. Womöglich entsteht dort wirklich noch ein neuer Stadtteil. Das Potential ist vorhanden.
Augenfällig sind die Verkehrsmaßnahmen. Straßen werden zu Fußgängerzonen umgewidmet, Stellplätze fallen weg. Ein Thema von Belang nicht nur für die rund 280.000 Menschen, die täglich nach Köln pendeln, sondern auch für den Einzelhandel. Er ist von der Pandemie gezeichnet und schaut mit Sorge auf den nächsten Herbst. Gibt es Gewinner und Verlierer dieses Wandels? Wie kann Köln für Arbeitgeber und -nehmer gleichermaßen attraktiv sein? Die Anziehungskraft dieser Stadt ist ungebrochen, die City randvoll mit Menschen aus nah und fern. Sind Urteile wie „hübsch“ oder „hässlich“ nur eine Frage der Perspektive?
Darüber wollen wir im Kölner Presseclub am Donnerstag, 2. Juni, 19:30 Uhr, im Excelsior Hotel Ernst diskutieren mit Dr. Nicole Grünewald, IHK-Präsidentin, Dr. Jürgen Amann, Chef von KölnTourismus und Dr. Witich Roßmann, Chef des Kölner DGB. Anmeldungen erbitten wir unter „info@koelner-presseclub.de“. Bitte Bestätigung abwarten. Und: Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.
Um in Stimmung zu kommen, habe ich mit Roberto Campione gesprochen, der in der jüngsten OB-Wahl kandidierte. Was der studierte Stadtplaner sagt, ist stets interessant. Ob Kopenhagen und Amsterdam als Radfahrerstädte ein Beispiel für Köln sein könnten, wie es in mancher Wahlwerbung hieß? „Aber sicher„, stimmt der 49-jährige zu. Wäre es so, böte der öffentliche Nahverkehr in Köln tatsächlich eine Alternative zum Auto. Dann würden Quartiersgaragen eingerichtet. Womöglich entstünde ein echtes Miteinander von Fußgängern, Rad- und Autofahrern.
Campione gerät ins Schwärmen, wenn er von Kopenhagen berichtet, wo Auto- und Radfahrer sich lächelnd und winkend verständigten. Dieses freundliche Miteinander vermisst er im hiesigen Verkehrsalltag. „Da herrscht Ellenbogenmentalität und keiner ist zufrieden.“ Neulich erst sei er von einem Kampfradler angebrüllt worden, als er in einer der neu eingerichteten „Flaniermeilen“ tat, was der Name verspricht: flanieren.
Seit kurzem ist Roberto Campione 1. Vorsitzender des Wirtschaftsclubs Köln. Er will sich einbringen, weil er an die Zukunft der Stadt glaubt. Sie müsse das weltstädtische Potential heben, das sie auszeichnet, sagt er. Der Rhein als d e r deutsche Fluss verbinde die zwei Hälften Kölns, der Dom als Weltkulturerbe habe internationale Geltung, Karneval bringe der Stadt nicht nur eine Milliarde Euro an Umsätzen. Vielmehr sei er als Kulturgut tief verwurzelt sowohl in Alltags- als auch in Hochkultur und damit ein Alleinstellungsmerkmal.
Straßen-Möblierung in Deutz mit welkem Gewächs –
Roberto Campione kritisiert, die Stadt agiere halbherzig.
Foto: Peter Pauls
Mit der Via Culturalis, die praktisch bereits vorhanden sei, der archäologischen Zone sowie der dem Dom benachbarten historischen Mitte verfüge Köln über weiteres weltstädtisches Potential, das nur gehoben und professionell präsentiert werden müsse. Das gelte auch für die Entwicklung neuer Hafenprojekte wie in Deutz. Warum nicht auch hier um Rat fragen, regt er an. Etwa in Hamburg, wo der Wandel des Hafens perfekt umgesetzt worden sei.
Schließlich entwirft er die Idee einer Laufbandverbindung zwischen Hauptbahnhof und dem Deutzer Nachbarn sowie einer Ost-West-U-Bahn, die den Rhein unterquert und erst auf Höhe des Melatenfriedhofs oberirdisch wird. Die Deutzer Brücke könne als weltstädtische Flaniermeile zur grünen Querung des Rheins werden. Zwei Rennradler, die forsch nebeneinander über die Deutzer Freiheit brettern, reißen ihn mit ihrer lauten Unterhaltung aus den Träumereien.
In Kürze wird auch diese Straße Fußgängerzone. Offiziell heißt es, das sei mit dem Handel positiv abgestimmt. Wie auch am Eigelstein stellt sich das anders dar, wenn man mit Geschäftsinhabern spricht. „Nie sei er gefragt worden“, sagt etwa Ralf Luhr, der in dritter Generation ein Lotto-Toto-Tabakwarengeschäft betreibt, stellvertretend für andere. Corona habe er mit einem blauen Auge überstanden. Nun sorgen ihn erneute Umsatzeinbußen.
Auch das ist ein Thema für Köln. Setzt sich eine eloquente Schicht politisch durch? Menschen, die sich artikulieren und organisieren können und der Politik Vorlagen liefern? „Da lässt sich keiner den Mund verbieten“, sagt Campione nüchtern und setzt spitz hinzu: „Das geschieht höchstens mit Andersdenkenden.“
Vor uns liegt ein spannendes Wochenende. NRW wählt. Das größte Bundesland ist ein Inkubator, ein politischer Brutkasten. Hier werden Richtungen vorgegeben.
Neugierige Grüße sendet
Ihr
Peter Pauls
[post-views]